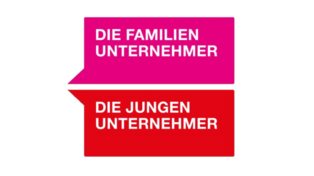Alternative Steuerfinanzierung?
Zur Dämpfung des Beitragssatzes der Sozialen Pflegeversicherung wird immer wieder der Einsatz von Steuermitteln gefordert. Warum das keine nachhaltige Finanzierungslösung ist, zeigen die folgenden Ausführungen.
Steuermittel und Demografie
Die kommenden demografischen Veränderungen und insbesondere die Alterung der Babyboomer-Jahrgänge werden in der umlagefinanzierten Sozialen Pflegeversicherung (SPV) zu niedrigeren Einnahmen bei steigenden Ausgaben führen – und damit Beitragssatzsteigerungen notwendig machen. Wenn die Beiträge allerdings nicht dauerhaft steigen sollen, müsste der SPV-Beitragssatz durch Steuermittel auf dem heutigen Niveau gehalten werden.
Hierzu wäre ein kontinuierlich wachsender Steuerzuschuss zur SPV erforderlich. Schon im Szenario ohne Kostendruck (d. h. die Einnahmen in der SPV entwickeln sich genauso wie die Ausgaben) und ohne Berücksichtigung der Kostenwirkungen der vergangenen Pflegereform müsste dieser im Jahr 2030 rund 6,0 Mrd. Euro umfassen. Dies erscheint im Hinblick auf die vergangene Entwicklung jedoch unwahrscheinlich und stellt den Mindestbetrag dar. Bei realistisch anzunehmendem Kostendruck (d. h. die Ausgaben steigen stärker als die Einnahmen) könnte der Steuerzuschuss bis 2030 jährlich 10,1 Mrd. Euro betragen. Würde die Entwicklung der letzten 10 Jahre fortgeschrieben, wäre gar ein Steuerzuschuss von bis 26,5 Mrd. Euro nötig.
Steuermilliarden für die Pflege sind nur die Spitze des Eisberges
Eine Steuerfinanzierung in der Sozialen Pflegeversicherung ist eine enorme Belastung für die jungen Generationen. Wie teuer und wie wenig nachhaltig Steuersubventionen grundsätzlich in der Sozialversicherung sind, machen die Ökonomen Prof. Martin Werding und Prof. Thiess Büttner in einem Gutachten deutlich. Es zeigt, dass die Defizite in der Sozialversicherung demografiebedingt kein vorübergehendes Problem sind, sondern sich von Jahr zu Jahr verschärfen. Bundeszuschüsse sind keine Lösung. Es braucht echte Strukturreformen. Denn Steuerzuschüsse gefährden langfristig Zukunftsinvestitionen.
Die finanzielle Schieflage der Sozialversicherungssysteme
Das Gutachten von Büttner und Werding zeigt zudem, dass die Beitragssätze der Sozialversicherungen unter dem derzeit geltenden Recht bereits in der vergangenen Legislaturperiode des Bundestags (2021-2024) hätten merklich angehoben werden müssen und sich der Anpassungsbedarf in der folgenden Legislaturperiode weiter fortsetzt. Die Projektionen der Wissenschaftler weisen für 2030 eine Sozialabgabenquote von 44,8 Prozent aus - und das, obwohl alle Sozialversicherungszweige mit regelmäßigen milliardenschweren Bundesmitteln gestützt werden.
Wenn die Politik nicht gegensteuert, wird es nicht möglich sein, die Sozialabgabenquote wieder auf unter 40 Prozent zu senken – mit allen ungünstigen Auswirkungen für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und den hiesigen Arbeitsmarkt.
Keine langfristig tragfähige Lösung: Die Stabilisierung der Beitragssätze durch Steuermittel
Um die Beitragssätze der Sozialversicherungen ohne ausgabenseitige Reformen auf 40 Prozent zu begrenzen, hätten laut Büttner und Werding allein bis zum Ende der 20. Legislaturperiode rund 60 Milliarden Euro mehr Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden müssen. Insgesamt werden die Bundeszuschüsse von heute rund 200 Milliarden Euro auf rund 275 Milliarden Euro im Jahr 2030 steigen.
Bereits heute hat der Bundeshaushalt einen enormen Konsolidierungsbedarf; zumal der Staat auch seiner Finanzierungsverantwortung für Bildung, Digitalisierung, Verkehrsinfrastruktur, Verteidigung etc. nachkommen muss. Der Handlungsspielraum für weitere Bundeszuschüsse in die Sozialversicherungssysteme – zusätzlich zu den bestehenden Zuschüssen – ist schlicht nicht vorhanden.
Um die Ausweitung der Bundeszuschüsse zu vermeiden, könnte rein sachlogisch auch ein Anstieg der Besteuerung vorgesehen werden. Auch hier warnen Autoren der Studie: „Gegen eine solche Steuerfinanzierung spricht indes, dass bestehende Lasten dadurch letztlich nur anders verteilt, aber nicht verringert werden.“
Einziger Weg: Strukturreformen
Wir können in der demografischen Situation, auf die wir zusteuern, nicht im selben Umfang wie bisher alle sozialen Lasten finanzieren; der Handlungsspielraum der heutigen Regierung und zukünftigen Bundesregierungen würde sich dadurch dramatisch verengen. Auch Büttner und Werding betonen, dass eine „Stabilisierung der Beitragssätze ohne Strukturreformen in den einzelnen Sozialversicherungszweigen schwerlich gelingen wird.“
Um das strukturelle Defizit kurzfristig auszugleichen, müssen angesichts der ausgereizten Einnahmeseite auch kurzfristig wirksame Korrekturen auf den Prüfstand. Dabei ist zu fragen, wo die Solidarität der Beitragszahlergemeinschaft notwendig ist und wo mit Blick auf das finanzielle Leistungsvermögen mehr Eigenverantwortung zugemutet werden kann. Dabei ist auch eine aktuelle Studie des IGES zu den stationären Eigenanteilen nach § 43c SGB XI zu berücksichtigen: Bereits im Jahr 2022 kosteten diese Zuschüsse zu den pflegebedingten Kosten in Pflegeheimen die SPV 3,6 Mrd. Euro. Bis zum Ende dieser Legislaturperiode (2029) werden die Kosten auf bis zu 9,4 Mrd. Euro steigen. Soweit diese SPV-Leistungen mit der Abwendung von Altersarmut begründet werden, verfehlen sie weitgehend dieses Ziel. Vielmehr ermöglichen sie einen Vermögens- und Erbenschutz, der mit einer überproportional hohen Belastung von Menschen mit niedrigem Einkommen durch Sozialversicherungsbeiträge verbunden ist. Dies ist aus Sicht der Studien-Autoren verteilungspolitisch bedenklich.