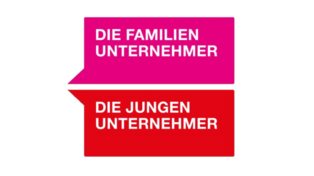Handlungsbedarf auf der Leistungsseite
Wenn wir in der demografischen Situation, auf die wir zusteuern, alle sozialen Lasten nicht mehr im selben Umfang wie bisher finanzieren können, muss die Leistungsseite der Gesetzlichen Pflegeversicherung betrachtet werden.
Begrenzung der Dynamik bei den Ausgaben zur vollstationären Pflege
Im Jahr 2022 wurden die Leistungen der Gesetzlichen Pflegeversicherung bei vollstationärer Pflege durch einen prozentualen Zuschuss zu den pflegebedingten Eigenanteilen erheblich ausgeweitet (§ 43c SGB XI). Die Höhe des Zuschusses richtet sich danach, wie lange bisher Leistungen der vollstationären Pflege in Anspruch genommen wurden, und steigt stufenweise und abhängig von der Dauer des stationären Aufenthalts auf bis zu 75 Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten bei mehr als 36 Monaten Heimaufenthalt.
Der Gesetzgeber hatte die Kosten bei Einführung des Zuschusses für das Jahr 2022 auf 2,75 Milliarden Euro geschätzt. Schon drei Jahre später sind diese Ausgaben der Sozialen Pflegeversicherung bereits mehr als doppelt so hoch.
Je nach Szenario werden die Ausgaben für die Leistungszuschläge weiter zunehmen. Unter der Voraussetzung, dass die Dynamik bei den Pflegekosten und Eigenanteilen abnimmt, rechnet das IGES-Institut mit Ausgaben für die Zuschüsse nach § 43c SGB XI bis 2029 von bis zu 9,4 Mrd. Euro p.a.. Das Wissenschaftliche Institut der PKV (WIP) kalkuliert mit bis zu 13,9 Mrd. Euro p.a..
Begründet werden diese SPV-Leistungen mit der Abwendung von Altersarmut, faktisch ermöglichen sie einen Vermögens- und Erbenschutz, der mit einer überproportional hohen Belastung von Menschen mit niedrigem Einkommen durch Sozialversicherungsbeiträge verbunden ist. Dies ist aus Sicht der IGES-Studien-Autoren verteilungspolitisch bedenklich.
Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) zum Vermögen und Einkommen deutscher Rentnerhaushalte belegt in diesem Kontext: gut 7 von 10 Haushalten (71,9 Prozent) im Rentenalter sind in der Lage, für eine Person 5 Jahre lang die Kosten vollstationärer Pflege aus eigener Kraft (Einkommen und Erspartes) zu finanzieren. Die Autoren der Studie kritisieren die pauschale Entlastung dieser Haushalte, ohne deren Finanzierungspotenziale zu berücksichtigen: „Das Instrument wirkt wenig treffsicher, provoziert deshalb einen hohen fiskalischen Aufwand und erhöht damit die Finanzierungserfordernisse in der Sozialen Pflegeversicherung. Aus ökonomischer Sicht muss der Leistungszuschlag daher insgesamt sowohl als ineffektives als auch ineffizientes Umverteilungsinstrument bewertet werden.“
Auch der aktuelle Alterssicherungsbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales attestiert der heutigen Rentnergeneration eine gute Einkommenssituation: „Insgesamt ist die heutige Rentnergeneration überwiegend gut abgesichert. Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen von älteren Paaren liegt bei monatlich 3.759 Euro. Bei alleinstehenden Männern sind es 2.213 Euro, alleinstehende Frauen haben mit 1.858 Euro ein im Durchschnitt geringeres Einkommen.“ Zudem wird darauf hingewiesen, dass auch eine niedrige gesetzliche Rente keinen Rückschluss auf ein geringes Gesamteinkommen zulasse und auch andere Faktoren – wie zusätzliche Altersvorsorge, zusätzliche Einkünfte oder das Einkommen des Partners – für das Gesamteinkommen des Haushalts zu berücksichtigen seien.
Überprüfung der Wirkung des Pflegegrades 1
In Pflegegrad 1 werden Menschen eingestuft, die nur geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen. Ziel seiner Einführung im Jahr 2017 war es, Menschen frühzeitiger zu unterstützen und insbesondere präventive Maßnahmen rechtzeitig und wirkungsvoll zum Einsatz zu bringen. Pflegebedürftige mit diesem Pflegegrad haben daher u. a. Anspruch auf eine umfassende individuelle Beratung, auf einen monatlichen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro und auf die Versorgung mit Hilfsmitteln.
Aus einer Untersuchung von Medicproof, dem medizinischem Dienst der Privaten Krankenversicherung, geht hervor, dass der Pflegegrad 1 seine ursprünglichen Ziele nicht erreicht hat. Entgegen dem weit verbreiteten Bild von Pflegebedürftigkeit seien Versicherte des Pflegegrads 1 in vielen Bereichen noch selbständig. „Die Analyse der Daten und die Einschätzungen der Gutachterinnen und Gutachter deuten darauf hin, dass der frühe Kontakt mit Pflegeleistungen nicht dazu geführt hat, dass Präventionsangebote und -leistungen vermehrt in Anspruch genommen werden.“
Um den steigenden Pflegebedarf im Zeitverlauf und im Gesamtumfang zu dämpfen – um nicht zuletzt die knappen finanziellen und personellen Ressourcen zu schonen – sollte der Leistungsumfang des Pflegegrades 1 überprüft und konsequent auf Prävention ausgerichtet werden.
Auch eine Studie des Instituts für Versicherungswesen an der TH Köln kommt nach der Analyse der Begutachtungsdaten privat Pflegebedürftiger zu folgendem Schluss für die gesetzliche Pflegeversicherung: “Die zunehmende finanzielle Beanspruchung der Pflegeversicherung unterstreicht die Notwendigkeit, Ressourcen bedarfsgerechter einzusetzen und Prävention als zentralen Bestandteil der Leistungserbringung zu stärken.”
Präventive Neuausrichtung des SGB XI
Ein Blick in die Praxis zeigt: Vor allem die ambulante Pflegeprävention spielt bislang kaum eine Rolle. Wo wir heute bei der Pflege im häuslichen Setting stehen und was getan werden kann, um das Potenzial von Prävention in der Versorgung zuhause zu heben, zeigt ein Diskussionspapier des IGES Instituts „Prävention in der Pflege – Impulse für eine präventive Neuausrichtung des SGB XI“, das auf einer gemeinsamen Fachveranstaltung der IGP und des IGES Instituts vorgestellt wurde.
Mehr dazu auf www.generationengerechte-pflege.de
Demnach beinhaltet das SBG XI nur unzureichende Präventionsleistungen: „85 Prozent der Pflegebedürftigen werden häuslich gepflegt. Das ist eine Gruppe, die noch mehr Präventionspotenziale aufweist“, so das Fazit von Dr. Grit Braeseke, Bereichsleiterin Pflege am IGES Institut. Trotz des 2017 eingeführten neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, der sehr präventive Elemente enthält, hapere es an der Umsetzung der Selbstverwaltung: „Bisher haben wir noch immer eine mangelnde Umsetzung in den Landesrahmenverträgen. Die Leistungskataloge der ambulanten Pflege sind körperbezogen, verrichtungsorientiert und ermöglichen keine ganzheitliche, individuelle, auch präventiv ausgerichtete Versorgung."
Die Empfehlungen des Papiers richten sich an Personen ohne Pflegebedarf, bei denen das Begutachtungsverfahren bei krankheitsbedingter Prävention und Stärkung individueller und sozialer Ressourcen ansetzen soll. Sind Personen bereits pflegebedürftig, empfiehlt das Papier, neben den gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch die Ressourcen der pflegebedürftigen Person zu beachten. Das umfasst: Umsetzung eines personenzentrierten Ansatzes und Berücksichtigung des familiären Umfelds, ein Case-Management zur Steuerung und Koordinierung der pflegerischen Versorgung sowie eine enge Abstimmung und gemeinsame Entscheidungsfindung mit den betreuenden Ärzten und Gesundheitsfachkräften. Um dies umsetzen zu können, braucht es:
- eine Anpassung der Landesrahmenverträge nach § 75 SGB XI mit dem Ziel, mehr Handlungsspielraum für die Pflegekräfte zu schaffen und eine Leistungserbringung im Sinne des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zu fördern;
- eine Kopplung des Pflegegeldbezugs an verpflichtende Beratungsbesuche (§ 37 Abs. 3 SGB XI);
- eine stärkere Hebung der Präventionspotenziale von Personen mit PG 1, indem ihnen standardmäßig eine Beratung zu Präventionspotenzialen angeboten wird;
- eine Weiterentwicklung der Pflegeberatung sowohl für Personen mit absehbarem Pflegebedarf als auch nach Erteilung eines Pflegegrades, wo auf Basis einer standardisierten Bewertung der Ressourcen ein Maßnahmeplan erstellt wird, dessen Umsetzung von professionellen Case-Managerinnen und -Managern koordiniert wird;
- eine Erweiterung des Gestaltungsspielraums der Pflegefachpersonen, was insbesondere eine Abkehr von verrichtungsbezogenen Leistungskomplexen voraussetzt.